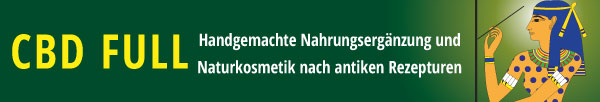Ringelblume (Calendula officinalis)
Die Ringelblume ist mehr als nur eine charmante Zierpflanze; sie ist eine Kraft der Natur mit einer reichen Geschichte in der traditionellen Klosterheilkunde.
Die Ringelblume besticht durch ihre leuchtend gelb-orangen, klebrigen Blüten und die haarigen, wechselständigen Blätter. Ihr Wuchs kann bis zu 60 cm erreichen und ihre Blütezeit erstreckt sich von Juni bis zum ersten Frost. Ein interessantes Merkmal der Pflanze ist ein alter Volksglaube, der besagt, dass ein geschlossener Blütenstand nach 7 Uhr morgens auf bevorstehenden Regen hindeutet.
Ernte und Aufbewahrung
Für die Verwendung in der Heilkunde sammelt man die Blüten und Blätter der Ringelblume bei sonnigem Wetter und lässt sie im Durchzug trocknen.
Die Ringelblume und Frauenleiden
In der Klosterheilkunde wird der Ringelblumentee zur Regulierung der Menstruation und zur Linderung von Wechseljahresbeschwerden geschätzt. Man trinkt ihn eine Woche vor der erwarteten Menstruation, schluckweise und ungesüßt.
Ringelblume für Magen und Darm
Die Ringelblumentee ist auch bekannt für ihre Unterstützung bei Magen- und Darmkrankheiten, Wassersucht, Dickdarmentzündung und Durchfall. Sie regt die Galle an und wirkt diuretisch, schweißtreibend und abführend.
Ringelblume bei Nervenleiden und Krebs
Der Ringelblumentee wird auch gegen Nervenkrankheiten verwendet und gilt als wertvolles Unterstützungsmittel bei Krebsbehandlungen.
Äußerliche Anwendung der Ringelblume
Eine Salbe aus Ringelblumen ist bei Hautproblemen wie Akne, Warzen, Geschwüren und Ekzemen hilfreich. Darüber hinaus fördert sie die Heilung von Verbrennungen und Erfrierungen. Zu diesem Zweck, bereitet man eine Salbe zu: Die Blüten langsam in Fett erhitzen, bis die ganze Feuchtigkeit verdampft ist. Filtern, in kleine Töpfchen gießen und an einem kühlen Ort aufbewahren. Die Salbe unterstützt das Wachstum des Granulationsgewebes, wodurch neue Zellen entstehen. Die Wunden heilen schnell.
Eine Ringelblumentinktur in Branntwein kann bei Muskelzerrungen, Blutergüssen, Quetschungen und Schwellungen angewendet werden.
Die Verwendung der Ringelblume in der Klosterheilkunde verdeutlicht, wie die Gaben der Natur zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden genutzt werden können - ein uraltes Wissen, das auch in der modernen Zeit nicht an Relevanz verloren hat.
Hinweis zur Anwendung der Rezepturen:
Hinweis zur Anwendung der Rezepturen:
- Die vorliegenden Rezepturen basieren auf historischen Quellen, insbesondere auf klösterlichen Aufzeichnungen, und wurden mit aktuellem phytotherapeutischem Fachwissen sowie modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen harmonisiert.
- Phytonzide – von Pflanzen gebildete bioaktive Substanzen mit antimikrobiellen Eigenschaften – spielen eine zentrale Rolle im Immunsystem und in der Abwehr pathogener Mikroorganismen, einschließlich Viren, resistenter Bakterien und Pilze. Ihre therapeutische Wirkung setzt eine exakte Zubereitung und Anwendung gemäß Anleitung voraus. Nur dann ist die Wirksamkeit der enthaltenen Phytonzide im Präparat gewährleistet.
- Da Heilpflanzen pharmakologisch aktive Inhaltsstoffe enthalten, können unerwünschte Wirkungen, Wechselwirkungen mit anderen Heilpflanzen oder Medikamenten sowie Kontraindikationen bei bestimmten Erkrankungen auftreten. Bitte prüfen Sie vor der Anwendung alle sicherheitsrelevanten Aspekte sorgfältig. Es wird dringend empfohlen, vor der Anwendung ärztlichen Rat oder den einer qualifizierten medizinischen Fachperson einzuholen, insbesondere bei bestehenden gesundheitlichen Problemen oder laufender Medikation.
- Bitte informieren Sie Ihren behandelnden Arzt über die Anwendung pflanzlicher Präparate, um Risiken zu minimieren und eine integrative Therapieplanung zu ermöglichen.
Sicherheitsaspekte bei der Anwendung
Sicherheitsaspekte bei der Anwendung von Ringelblume (Calendula officinalis)
1) Wechselwirkungen
Bislang sind keine signifikanten pharmakologischen Wechselwirkungen zwischen Ringelblumenextrakten und anderen Arzneimitteln dokumentiert. Dennoch ist bei gleichzeitiger innerlicher oder äußerlicher Anwendung anderer Medikamente – insbesondere kortikoidhaltiger oder immunsuppressiver Präparate – Vorsicht geboten, da theoretisch eine Verstärkung oder Abschwächung entzündungshemmender Effekte auftreten kann. Auch bei gleichzeitiger Anwendung mit alkoholhaltigen Tinkturen kann es bei empfindlicher Haut zu kumulativen Reizungen kommen. Bei Einnahme von Medikamenten zur Gerinnungshemmung (z. B. Acetylsalicylsäure, Warfarin) ist eine ärztliche Rücksprache empfehlenswert, da die Ringelblume leicht gerinnungshemmende Eigenschaften besitzen kann.
2) Kontraindikationen
Die Anwendung von Ringelblumenpräparaten ist kontraindiziert bei:
- Überempfindlichkeit gegen Korbblütler (Asteraceae), wie Kamille, Arnika, Schafgarbe, Beifuß oder Sonnenhut. Kreuzallergien sind möglich und können schwerwiegende allergische Reaktionen auslösen.
- Schweren Hauterkrankungen wie atopischer Dermatitis, offenen oder infizierten Wunden ohne ärztliche Überwachung. Hier kann eine Sekundärinfektion durch Okklusion oder falsche Anwendung begünstigt werden.
- Asthma bronchiale oder atopischer Veranlagung, da diese Patientengruppen empfindlicher auf pflanzliche Allergenkomponenten reagieren können.
3) Nebenwirkungen
Ringelblume gilt grundsätzlich als gut verträglich. Dennoch können folgende Nebenwirkungen auftreten:
- Allergische Hautreaktionen wie Kontaktdermatitis, Juckreiz, Rötung oder Schwellung, besonders bei Personen mit Sensibilität gegenüber Korbblütlern.
- Phototoxische Reaktionen sind zwar selten, aber nicht ausgeschlossen. Bei Anwendung alkoholischer Tinkturen auf der Haut ist direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
- Bei innerlicher Anwendung (z. B. als Tee oder Tinktur) sind sehr selten Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall beschrieben.
4) Vorsichtsmaßnahmen
Für eine sichere Anwendung sollten folgende Hinweise beachtet werden:
- Keine Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren, außer unter ärztlicher Aufsicht. Die Hautbarriere ist in diesem Alter noch empfindlich.
- Während Schwangerschaft und Stillzeit sollte die Anwendung – insbesondere innerlich – nur nach Rücksprache mit einer medizinischen Fachkraft erfolgen, da keine ausreichenden Studien zur Unbedenklichkeit vorliegen.
- Bei länger andauernden Hautveränderungen, nässenden Ekzemen oder unklaren Symptomen sollte stets eine medizinische Abklärung erfolgen, um Fehldiagnosen oder Verschleppung einer Grunderkrankung zu vermeiden.
- Eigenhergestellte Zubereitungen aus frischen Ringelblumen können eine höhere Konzentration reizender Inhaltsstoffe (z. B. Sesquiterpenlactone) enthalten – standardisierte Fertigpräparate bieten in der Regel eine bessere Verträglichkeit und Sicherheit.
- Test auf Hautverträglichkeit: Vor großflächiger Anwendung empfiehlt sich ein Vorabtest auf einer kleinen Hautstelle (z. B. in der Ellenbeuge) über 24 Stunden.
Forschungen
Wissenschaftliche Forschung zur Wirkung der Ringelblume (Calendula officinalis)
Die Ringelblume ist intensiv Gegenstand moderner Studien, insbesondere in Bezug auf Wundheilung, Entzündungshemmung, antimikrobielle und antioxidative Effekte. Zuverlässige Quellen sind u. a. PubMed, Wiley, J Ethnopharmacol. Im Folgenden findest du eine Auswahl aktueller Publikationen mit Klick auf Titel-Link:
- Or Givol et al. (2019): Systematic review of Calendula officinalis extract for wound healing – 7 klinische + 7 Tierstudien (u. a. schnellere Granulationsbildung) (Wound Repair Regen) (PubMed)
- Bevilacqua et al. (2021): Randomisierte kontrollierte Studie – schnellere Epithelisierung akuter Handverletzungen (Tissue Barriers) (PubMed)
- Nicolaus et al. (2017): In-vitro MWScan – Wirkung auf NF-κB, IL-8, Kollagenasehemmung, erhöhte Kollagenbildung (J Ethnopharmacol)
- Buzzi et al. (2016): Klinische Studie – signifikanter Wundheilungsvorteil bei venösen Beingeschwüren (J Wound Care)
- Ozturan et al. (2025): 5 % Calendula-Extrakt bei Mauswunden – verbesserte Fibroblasten-Aktivität, weniger Entzündungsmarker (Cutan Ocul Toxicol)
- Tahami et al. (2022): Pilottest nanofaser‑Wundauflagen mit Calendula – gesteigerte Heilungsraten bei Ratten
- Sayyah et al. (2023): Orale Einnahme von Calendula-Kapseln bei Verbrennungen – schnellere Heilung 2. Grades in RCT
Diese Arbeiten decken verschiedene Anwendungsbereiche ab:
- Akute Wunden & Verbrennungen: Randomisierte Studiendaten zeigen gesteigerte Epithelbildung und schnelleren Wundverschluss bei äußerlicher Therapie.
- Chronische Ulzera: Besonders bei venösen Beingeschwüren weisen Studien auf einen messbaren Heilungsvorsprung im Vergleich zur Kontrolle hin.
- Mechanismen: In vitro‑Daten belegen entzündungshemmende Wirkung (Hemmen von NF‑κB, COX‑2) und Förderung der Kollagensynthese.
- Neue Formulierungen: Innovativ sind Nanofasertragkörper‑Technologien, die Calendula integrieren und die Wundheilung in Tiermodellen unterstützt haben.
- Orale Anwendung: Hinweise auf Nutzen bei Verbrennungswunden auch durch systemische Anwendung.
Fazit: Die Datenlage zur Ringelblume ist vielversprechend, besonders bei Hautwunden und Ulzera, wenngleich größere, multizentrische Studien erforderlich sind, um klinische Anwendungsempfehlungen zu verfestigen.
Häufig gestellte Fragen
Welche medizinischen Eigenschaften hat die Ringelblume (Calendula officinalis)?
Ringelblume wird mit entzündungsmodulierenden, wundheilungsfördernden und antioxidativen Eigenschaften in Verbindung gebracht. Traditionell wird sie zur Unterstützung der Hautregeneration bei kleineren Verletzungen und Reizungen eingesetzt.
Wie wird Ringelblume typischerweise angewendet?
Ringelblume wird vor allem äußerlich in Form von Salben, Cremes, Tinkturen oder Umschlägen angewendet. Auch Teezubereitungen sind gebräuchlich. Die häufigste Anwendung betrifft die Pflege gereizter oder beanspruchter Haut.
Gibt es wissenschaftliche Studien zur Wirkung der Ringelblume?
Untersuchungen beschreiben positive Effekte auf Wundheilungsprozesse sowie entzündungsmodulierende Eigenschaften. Weitere klinische Studien sind erforderlich, um die therapeutische Wirksamkeit umfassend zu bewerten.
Ist die Anwendung der Ringelblume sicher?
Ringelblume gilt in üblicher Anwendung als gut verträglich. Personen mit Allergien gegen Korbblütler sollten vorsichtig sein. Bei größeren oder offenen Wunden sowie während Schwangerschaft und Stillzeit sollte vor der Anwendung fachlicher Rat eingeholt werden.
Wo finde ich mehr Informationen zur Ringelblume?
Weitere Informationen zur Pflanze, ihren Inhaltsstoffen und traditionellen Anwendungen finden Sie im Heilpflanzenlexikon der Antiken Apotheke sowie in pharmakologischen Fachpublikationen.