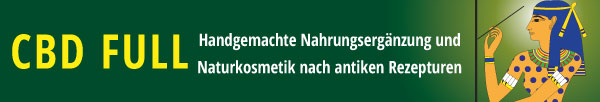Europa von der Renaissance bis zum 19. Jahrhundert: Oxymel, Sirupe & Shrubs
Während der Renaissance und der frühen Neuzeit fand das Oxymel seinen festen Platz in der europäischen Heilkunst. Die Rezepturen, die seit der Antike in der griechischen und persischen Medizin bekannt waren, wurden von den Klöstern und Apotheken übernommen und in den Pharmakopöen der Zeit standardisiert. Besonders das Oxymel squilliticum – ein Sirup aus Honig, Essig und Meerzwiebel
(Squill) – galt als bewährtes Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemwege und wurde in der britischen Pharmakopöe bis ins 20. Jahrhundert geführt. Damit zeigt sich eine bemerkenswerte Kontinuität: eine Mischung aus Essig und Honig, die schon in der Antike verwendet wurde, blieb über Jahrhunderte Teil der amtlichen Arzneibücher Europas.
Pharmazie und Alltagsgetränke: Oxymel squilliticum und die Entstehung der Shrubs
Parallel dazu entwickelte sich in der weltlichen Ernährungskultur eine neue Tradition: die sogenannten „Shrubs“. Ursprünglich handelte es sich dabei um Frucht-Essig-Sirupe, die mit Zucker angesetzt wurden, um Obst länger haltbar zu machen. Der Essig wirkte konservierend, während die Süße den Geschmack abrundete. Diese Sirupe waren im 17. und 18. Jahrhundert in England weit verbreitet, fanden bald ihren Weg in die Kolonien Nordamerikas und wurden dort als alkoholfreie Erfrischungsgetränke oder als Bestandteil von Punches und später Cocktails geschätzt.
Von der Klostermedizin zur Cocktailkultur: Essig-Sirupe zwischen Heilkunst und Genuss
Im Unterschied zum streng medizinischen Oxymel wandelte sich der Shrub zu einem kulinarischen Produkt: ein Bindeglied zwischen Vorratshaltung, Genusskultur und – indirekt – Gesundheitsbewusstsein. Seine Rolle als „drinking vinegar“ brachte nicht nur Abwechslung in die Getränkekultur, sondern gilt heute auch als Vorläufer moderner Functional Drinks. Damit spiegelt die Entwicklung vom Renaissance-Oxymel bis zu den Shrubs des 19. Jahrhunderts zwei zentrale Strömungen wider: die Professionalisierung der Pharmazie einerseits und die zunehmende Bedeutung von Geschmack, Haltbarkeit und sozialem Konsum in der Alltagskultur andererseits. Beide Traditionen – die medizinische und die kulinarische – greifen auf dieselbe Grundidee zurück: die Mischung von Essig und Süßungsmitteln als Träger für Heilpflanzen, Früchte und Wirkstoffe.
Oxymel in europäischer Pharmazie
In der Renaissance und im frühen 19. Jahrhundert wurde Oxymel in Apothekenlisten und Pharmakopöen als heilkräftiger Sirup geführt. Die britische Pharmakopöe listete Oxymel squilliticum bis in moderne Ausgaben des 20. Jahrhunderts – vor allem zur Unterstützung der Atemwege und als Expektorans.
In lateinischer Fachsprache erscheinen Varianten wie oxymel, oxymellus oder oxymeli auch in medizinischen Kompendien der Frühen Neuzeit; die Zubereitung diente als Träger, Geschmackskorrektiv und Konservierungsmedium für pflanzliche Wirkstoffe.
Entstehung & Geschichte von Shrubs (Frucht-Essig-Sirupe)
Der Begriff „Shrub“ (verwandt mit dem arabischen sharab – „Trank“) bezeichnete zunächst alkoholhaltige Fruchtmischungen, entwickelte sich im 17.–18. Jahrhundert in England aber vor allem als Methode zur Konservierung von Obst: Fruchtsaft wurde mit Essig und Zucker zu einem dickflüssigen Sirup verarbeitet.
In der kolonialen Ära Nordamerikas etablierte sich daraus der „drinking vinegar“ – als alkoholfreies Erfrischungsgetränk oder Mixer in Punches. Im 19. Jahrhundert finden sich zahlreiche Rezepte (z. B. Raspberry Shrub) in Kochbüchern und Haushaltsratgebern; im 20./21. Jahrhundert erlebten Shrubs im Zuge der Craft-Cocktail-Bewegung eine Renaissance.
Gesundheit & Nutzung damals & heute
Sirupe spielten in der europäischen Medizin nicht nur als eigenständige Rezepturen eine Rolle, sondern vor allem als Zuckersirupe zur Geschmackskorrektur und Stabilisierung pflanzlicher Zubereitungen. Essig-Sirupe wie Oxymel verbanden Süße mit Säure und boten so ein günstiges Medium, um Wirkstoffe aufzunehmen und zugleich haltbar zu machen.
Heute dienen Shrubs vor allem kulinarischen Zwecken: als ausgewogene, alkoholfreie Mixer mit Süße-Säure-Balance oder als Alternative zu Zitrus in Getränken. In Ernährungs- und Barpraxis werden sie wegen ihrer Aromatiefe und Lagerfähigkeit geschätzt.
Quellen & Hinweise
- British Pharmacopoeia (BP):
- British Pharmacopoeia 1867 – enthält Oxymel Scilliticum als offizielle Rezeptur (Squill-Sirup mit Honig & Essig).
- British Pharmacopoeia 1914 – weiterhin aufgeführt; Anwendung als Expektorans bei Atemwegserkrankungen.
- In späteren Ausgaben des 20. Jh. allmählich gestrichen, da synthetische Präparate aufkamen.
- Historische Koch- und Hauswirtschaftsbücher (Shrubs):
- Eliza Smith: The Compleat Housewife (1739, London) – frühe Rezepte für „Raspberry Shrub“ und „Cherry Shrub“ (Branntwein/Essig/Zucker/Frucht).
- Hannah Glasse: The Art of Cookery Made Plain and Easy (1758) – mehrere Shrub-Rezepte mit Frucht, Zucker und Essig.
- Mrs. Beeton: Book of Household Management (1861, London) – Shrubs als Teil häuslicher Getränkeversorgung; mit und ohne Alkohol.
- Sekundärliteratur & Fachartikel:
- Sweetman SC (Hrsg.): Martindale: The Complete Drug Reference, 36. Auflage, 2009 – dokumentiert die lange Tradition von Oxymel squilliticum in der europäischen Pharmakopöe.
- Walton, Stuart: Drinkology (2004) – Überblick über Shrubs und ihre Rolle in der Kolonialzeit sowie in der modernen Cocktailkultur.
- Wikipedia: Shrub (drink) – Überblick zur Geschichte und Wiederentdeckung von Frucht-Essig-Sirupen.
Hinweis: Primärquellen wie BP-Ausgaben oder historische Kochbücher sind im Original als Faksimile oder über Bibliotheksportale zugänglich (u. a. Google Books, archive.org, Wellcome Collection).
Hinweis zur Anwendung der Rezepturen:
Hinweis zur Anwendung der Rezepturen:
- Die vorliegenden Rezepturen basieren auf historischen Quellen, insbesondere auf klösterlichen Aufzeichnungen, und wurden mit aktuellem phytotherapeutischem Fachwissen sowie modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen harmonisiert.
- Phytonzide – von Pflanzen gebildete bioaktive Substanzen mit antimikrobiellen Eigenschaften – spielen eine zentrale Rolle im Immunsystem und in der Abwehr pathogener Mikroorganismen, einschließlich Viren, resistenter Bakterien und Pilze. Ihre therapeutische Wirkung setzt eine exakte Zubereitung und Anwendung gemäß Anleitung voraus. Nur dann ist die Wirksamkeit der enthaltenen Phytonzide im Präparat gewährleistet.
- Da Heilpflanzen pharmakologisch aktive Inhaltsstoffe enthalten, können unerwünschte Wirkungen, Wechselwirkungen mit anderen Heilpflanzen oder Medikamenten sowie Kontraindikationen bei bestimmten Erkrankungen auftreten. Bitte prüfen Sie vor der Anwendung alle sicherheitsrelevanten Aspekte sorgfältig. Es wird dringend empfohlen, vor der Anwendung ärztlichen Rat oder den einer qualifizierten medizinischen Fachperson einzuholen, insbesondere bei bestehenden gesundheitlichen Problemen oder laufender Medikation.
- Bitte informieren Sie Ihren behandelnden Arzt über die Anwendung pflanzlicher Präparate, um Risiken zu minimieren und eine integrative Therapieplanung zu ermöglichen.